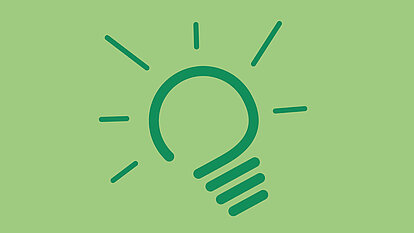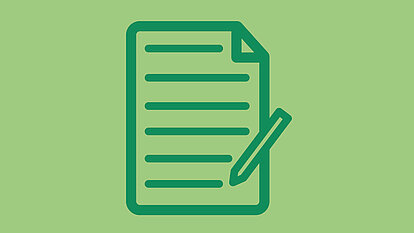Forschendes Lernen an der Hochschule Kaiserslautern
Antrag
Ihre Anträge können Sie über die Rubrik „Wettbewerbe“ im Campusboard einreichen.
Was ist Forschendes Lernen?
Das Forschende Lernen ist eine aktivierende Lernmethode, mit der Studierende ihren Wissenserwerb selbstständig organisieren und Fähigkeiten entwickeln mit komplexen Situationen umzugehen. Studierende gestalten, erfahren und reflektieren den Prozess eines Forschungsvorhabens in seinen wesentlichen Phasen.
Neuigkeiten
Projektvideos
Kompetenzerwerb für Studierende
- Vertiefte Einblicke in das wissenschaftliche Arbeiten
- Eigenständigkeit, selbstständiges Arbeiten
- Teamfähigkeit
- Selbstorganisation
- Forschungsmethoden können ausprobiert werden
- Einblicke in einen Forschungsprozess
Das Besondere am Forschenden Lernen ist die Möglichkeit für Studierende innerhalb einer Gruppe auszuprobieren und zu versuchen, einschließlich der Möglichkeit des Scheiterns. Die Studierende können die Erfahrungen aus ihren Projekten auswerten und so neue Lösungswege finden.
Frau Prof. Barbara Christin - Studiengangsleitung Digital Media Marketing
Aktuelle Projekte (Wintersemester 2025/2026)
Studiengang: Medieninformatik, Digital Media Marketing [Bachelor]
Antragsteller:in: Gustav Gutsche, Annika Sema, Prof. Dr. Dieter Wallach
Komparative empirische Untersuchung von Ablenkungseffekten der hands-free und handheld-Telefonie unter Rückgriff auf das Fahrsimulationslabor (Human-Computer Interaction Arbeitsgruppe HCI2B am Campus Zweibrücken).
In einer Analyse der einhundert am häufigsten zitierten Publikationen der international hochbedeutenden Fachtagung "ACM Computer-Human Interaction (ACM CHI)" zeigen Kaltenhauser, Savino, von Felten und Schöning (2025) eindrucksvoll die Relevanz empirisch-experimenteller Arbeiten im Umfeld der Mensch-Technik Interaktion auf: Zwei Drittel der Top 100-Publikationen seit Bestehen der ACM CHI umfassen empirische Daten als Bestandteil von Ausführungen zu User Research, Evaluation oder Validierung von Methoden, Technologien oder interaktiven Artefakten. Der dargestellten Bedeutung empirischer Methoden in der Informatik wird an der Hochschule Kaiserslautern in der Lehre Rechnung getragen: Bachelor-Studierende der Studiengänge Medieninformatik und Digital Media Marketing erhalten in der Veranstaltung "Angewandte Kognitionswissenschaft" eine Einführung in das empirisch-experimentelle Vorgehen und werden mit grundlegenden Konzepten der beschreibenden und schließenden Statistik anhand von Beispielen aus der Literatur vertraut gemacht. Ziel des beantragten Projektes zum Forschenden Lernen ist es, gemeinsam mit Studierenden eine eigene empirische Studie zu planen, umzusetzen, inferenzstatistisch auszuwerten und in einer Publikation zu dokumentieren.
Studiengang: Bauingenieurwesen [Master]
Antragsteller:in: Prof. Dr.-Ing. Carina Neff
Pilzmyzel besitzt die Fähigkeit, organische Substrate wie Holzreste oder Sägespäne zu durchwachsen und stabile, biologisch abbaubare Strukturen zu bilden. In der Materialforschung eröffnen sich durch diesen Prozess neue Wege für nachhaltige und ressourcenschonende Baustoffe. Im Zentrum steht die Nutzung von Pilzen wie Reishi (Ganoderma lucidum), Schmetterlingstramete (Trametes versicolor) und Austernseitling (Pleurotus ostreatus) zur Entwicklung alternativer Baumaterialien. Das Projekt verknüpft biologische Prozesse mit ingenieurtechnischen Anwendungen. Ziel ist es, die Machbarkeit, Festigkeit und Gestaltungspotenziale solcher lebenden Materialien im Labormaßstab zu untersuchen.
Studiengang: Architektur, Innenarchitektur, Bauingenieurwesen [Bachelor & Master]
Antragsteller:in: Prof. Dipl.-Ing. Brigitte Al Bosta
Ein Projekt zwischen Forschung, Kunst und Baupraxis: Im Sommersemester 2025 startete das Wahlpflichtfach TELM. Aufbauend auf den Ergebnissen aus dem Sommersemester wird im Wintersemester 2025/2026 das Wahlpflichtfach TELM 2.0 angeboten. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen aufbereitet, evaluiert und veröffentlicht werden. In dem Lehrforschungsprojekt, bestehend aus TELM und TELM 2.0, des Fachbereichs Bauen und Gestalten der Hochschule Kaiserslautern steht die Vernetzung der Studiengänge sowie die Förderung des experimentellen, künstlerischen und wissenschaftlichen Arbeitens im Zentrum. Theorie und Praxis werden verknüpft. Im Vordergrund steht die Materialforschung, bei der traditionelle Baumaterialien mit neuen, nachhaltigen Baustoffen kombiniert werden. Diese zielt darauf ab, Gebäude langlebiger, ressourcenschonender und energieeffizienter zu gestalten. Stampflehm und Lehmziegel erleben aufgrund ökologischer Überlegungen eine Renaissance. Bei der Entwicklung neuer ökologischer Bauweisen spielt die Transdisziplinarität eine entscheidende Rolle. Neben technischen Aspekten werden innovative künstlerische Konzepte berücksichtigt. Das Lehrforschungsprojekt „TELM 2.0” befasst sich mit der systematischen Dokumentation, Evaluation und Veröffentlichung experimenteller Entwicklungen im Bereich der sogenannten „Living Building Materials” (LBM). Im Zentrum stehen dabei innovative Kombinationen von terrestrischen Cyanobakterien mit natürlichen Baustoffen wie Lehm und Sand. Das Ziel besteht darin, das Potenzial biologisch aktiver Materialien als nachhaltige und CO₂-arme Alternative zu konventionellen Baustoffen wie Beton zu erfassen, zu bewerten und zu veröffentlichen. Auch bestehende Baustoffe wie Stampflehm oder Lehmziegel werden hinsichtlich ihrer Materialeigenschaften untersucht, weiterentwickelt und deren Verbesserungen nachvollziehbar aufgezeigt. Im Rahmen der interdisziplinären Labor- und Werkstattarbeit der Hochschule dokumentieren Studierende und Lehrende aus den Bereichen Architektur, Bauingenieurwesen, Kunst und Umwelttechnik ihre materialtechnischen und gestalterischen Experimente. Die gewonnenen Erkenntnisse bezüglich der strukturellen Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten der LBMs werden evaluiert und in geeigneter Form publiziert, sei es in Fachartikeln, Projektberichten oder öffentlichen Präsentationen. Ziel ist es, den Wissenstransfer und die Weiterentwicklung im Bereich nachhaltiger Baumaterialien aktiv zu fördern. Die Verbindung von Wissenschaft, Gestaltung und Nachhaltigkeit macht TELM zu einem zukunftsweisenden Projekt an der Schnittstelle zwischen Forschung, Kunst und Baupraxis.
Studiengang: Maschinenbau, Energieeffiziente Systeme, Mechatronik, Wirtschaftsinformatik [Bachelor] || Maschinenbau / Mechatronik, Elektrotechnik und Informationstechnik [Master]
Antragsteller:in: Florian Juner
Data Augmentation, Image Classification und Interpolation von Forschungsdaten mit Hilfe von Machine Learning und Deep Learning.
Studiengang: Architektur, Innenarchitektur [Bachelor & Master]
Antragsteller:in: Dipl.-Ing. (FH) Jochen Sinnwell
Die Studierenden untersuchen im Rahmen des Seminares, wie zeitgenössische architektonische Gestaltungsprinzipien in Form, Farbe, Materialdarstellung und Komposition durch KI-basierte Bildgenerierungstechnologien erfasst, rekonstruiert und ob Veränderungen vorgenommen werden. Im Zentrum steht die Frage, ob KI-Modelle wie Midjourney bestehende ästhetische Konventionen lediglich reproduzieren oder auch neue, eigenständige Bildwelten erzeugen und wie sich der Einfluss möglicher neuer KI-Bildwelten auf die eigene Entwurfspraxis auswirkt. In einem weiteren Schritt wird untersucht, wie KI-gestützte Bildwelten in eine eigenständige gestalterische Idee überführt werden können und welche neuen Perspektiven, Methoden und Ausdrucksformen dadurch für die eigene Entwurfspraxis entstehen.
Studiengang: Digital Media Marketing [Bachelor]
Antragsteller:in: Dipl.-Kffr. Anna-Lydia Imamovic
Welche Strategien eignen sich auf Instagram, um Studieninteressierte gezielt anzusprechen und eine emotionale Bindung zur Hochschule Kaiserslautern aufzubauen? Im Rahmen der Übung Grundlagen des Marketings wird ein praxisnahes und zugleich forschungsorientiertes Projekt realisiert. Die Studierenden entwickeln, testen und reflektieren ein redaktionelles Instagram-Konzept für den Kanal @campusvibes. Ziel des Projekts ist es, den Studierenden zu ermöglichen, den strategischen Einsatz von Social Media praktisch zu erproben. Dabei entwickeln sie konkrete Maßnahmen, um potenzielle Studieninteressierte gezielt anzusprechen und emotional an die Hochschule Kaiserslautern zu binden. Durch die Anwendung von Marketingmodellen, datenbasierter Analyse und kreativer Content-Erstellung vertiefen die Studierenden ihre Marketing-Grundlagen und bauen ihre Kompetenzen in digitaler Kommunikation und im forschenden Lernen aus.
Studiengang: Maschinenbau, Energieeffiziente Systeme, Mechatronik, Wissenschaftsinformatik [Bachelor] || Maschinenbau / Mechatronik, Elektrotechnik und Informationstechnik [Master]
Antragsteller:in: Edgar Hoffmann
Einfluss von LPBF-Fertigungsparametern auf Mikrostruktur, Defektbildung und Ermüdungsverhalten metallischer Werkstoffe
Studiengang: Architektur [Master]
Antragsteller:in: Prof. Dipl.-Ing. Architektin BDA Sabrina Wirtz
Das Projekt erforscht, wie Stroh als nachhaltiger Baustoff architektonisch gestaltet und vermittelt werden kann, um die Akzeptanz für das Bauen mit Stroh und biobasierten Baustoffen in der Gesellschaft zu stärken.
Wie können architektonische Entwurfsstrategien im Bauen mit Stroh entwickelt und kommuniziert werden, um die gesellschaftliche Akzeptanz für Stroh als Baustoff zu erhöhen und so einen wichtigen Beitrag zur Bauwende leisten?
Der Bausektor ist einer der größten Ressourcenverbraucher weltweit. Deshalb arbeiten Industrie und Wissenschaft verstärkt an Lösungen, um diesen immensen Bedarf zu reduzieren. Auch die Hochschule Kaiserslautern forscht (u.a. im Institut für Nachhaltigkeit) disziplinübergreifend zu der Fragestellung, wie die Baubranche nachhaltiger werden kann.
Es geht dabei schwerpunktmäßig um die Frage, wie verstärkt nachwachsende und regional erzeugte Werkstoffe im Bauwesen eingesetzt werden können. Zu den nachwachsenden Rohstoffen, die für nachhaltiges Bauen in Deutschland eingesetzt werden können, gehören insbesondere die Materialien Holz, Lehm, Hanf und Stroh. Während Holz bereits eine etablierte Bauweise darstellt und der Lehmbau zunehmend in den Fokus des fachlichen und öffentlichen Diskurses rückt, gilt es im Hinblick auf die Verwendung von Stroh für tragende und nichttragende Bauteile noch Herausforderungen zu bewältigen.
In aktuellen Forschungsvorhaben an der Hochschule Biberach, der Bauhaus-Universität Weimar und Hochschule Magdeburg-Stendal untersuchen Forschungsgruppen im Bereich Bauingenieurwesen das Verhalten von Stroh in tragenden und nichttragenden Bauteilen in Bezug auf Tragfähigkeit, Verformung, Bauphysik und Normung/Zulassung, um Bauen wieder in umweltverträgliche Grenzen zu führen. Dabei geht es insbesondere um die Reduktion von CO2-Emissionen und Abfallmengen.
Neben den materialspezifischen Fragestellungen bedarf es auch Antworten auf die Vorbehalte, auf die Bauen mit Stroh in der Baubranche und gesellschaftlich stößt. Um Stroh mittelfristig als echte Alternative zu den herkömmlichen Werkstoffen etablieren zu können, braucht es eine Kommunikationsstrategie, die zur Nachahmung anregt.
Diese Kommunikationsaufgabe kann Architektur übernehmen. An dieser Stelle setzt das Entwurfsmodul "GOLDEN CORN – Bauen mit Stroh" im Studiengang Architektur des Fachbereiches Bauen und Gestalten an der Hochschule Kaiserslautern an.
Ziel ist es, den besonderen Materialeigenschaften von Stroh mit spezifischen architektonischen Entwurfs- und Konstruktionsprinzipien zu begegnen. Dies erfolgt in einem architektonischen Ausdruck, der die Baukultur der Region fortschreibt, eine regionale Handwerklichkeit mit den Mitteln der Digitalisierung in Planung und Fertigung kombiniert und v.a. Vorhabentragende der Region und darüber hinaus anregt, mit Stroh zu bauen.
Studiengang: Elektrotechnik [Bachelor]
Antragsteller:in: B.Eng. Ömer Ata
Die Digitaltechnik ist eine zentrale Basistechnologie unserer Zeit und bildet die Grundlage für nahezu alle Produkte und Innovationen, die unseren Alltag prägen – von Alltagsgeräten bis hin zu komplexen Anwendungen in der Luft- und Raumfahrttechnik. Diese Bedeutung spiegelt sich auch im neuen Curriculum des Bachelorstudiengangs Elektrotechnik (ET24-B) wider: Die Digitaltechnik hat einen größeren Stellenwert erhalten und ist in allen Vertiefungsrichtungen als Pflichtmodul im dritten Fachsemester verankert. Damit wird sichergestellt, dass alle Studierenden unabhängig von ihrer späteren Spezialisierung fundierte Grundkenntnisse in diesem Gebiet erwerben.
Im Rahmen dieses Vorhabens soll die Lehrveranstaltung Digitaltechnik von Prof. Schütz und insbesondere das dazugehörige Labor um einen praxisnahen, forschungsorientierten Projektanteil erweitert werden. Ziel ist es, die Studierenden bereits im dritten Fachsemester an eine im Ingenieursalltag wie auch in der angewandten Forschung zentrale Methodik heranzuführen:
Theorie → Simulation → Implementierung → Experiment/Hardware → Reflexion
Die Studierenden durchlaufen dabei den gesamten Entwicklungszyklus – von der theoretischen Analyse über die Simulation digitaler Schaltungen bis zur Umsetzung auf echter Hardware und deren experimenteller Überprüfung mit geeigneten Messmitteln. Der Prozess ist bewusst ergebnisoffen gestaltet, sodass auch Fehlversuche als wertvolle Lernerfahrungen genutzt werden.
Als zentrale Plattform kommen relativ kostengünstige Experimentierboards (DEB100 von ELV) zum Einsatz, die eine direkte Umsetzung der in Vorlesung und Simulation entwickelten Schaltungen in Hardware ermöglichen. Die Arbeit in kleinen Teams erfolgt anhand mehrerer klar abgegrenzten Fragestellungen, die inhaltlich aufeinander aufbauen und so schrittweise zu einer komplexeren Gesamtaufgabe führen.
Das Projekt verbindet die Vermittlung technischer Grundlagen mit dem Erwerb methodischer, sozialer und kommunikativer Kompetenzen. Es stärkt das Verständnis für den iterativen Charakter der Lösungsfindung im Allgemeinen und ingenieurwissenschaftlicher Arbeit im Besonderen. Die Durchführung im dritten Semester stellt sicher, dass die Studierenden frühzeitig den Mehrwert praxisnaher, forschungsorientierter Arbeit erfahren und diese Herangehensweise als integralen Bestandteil ihrer weiteren Ausbildung verinnerlichen.
Studiengang: Mechatronik [Bachelor]
Antragsteller:in: Christian Malschofsky
Für den Wettbewerb Trinatronix haben wir im Rahmen unserer mechatronischen Arbeit einen Assistenzroboter als Prototyp entwickelt. Durch den enormen Zeitdruck wurde aus dem Projekt nur ein Proof of Concept. Daher möchten wir in dieser studentischen Initiative die Weiterentwicklung des Proof-of-Concept umgesetzten Assistenzroboters für blinde und sehbehinderte Menschen zu einem voll funktionsfähigen Prototyp angehen. Ziel ist es, mithilfe zusätzlicher Hardware (u.a. maßgefertigte 3D-gedruckte Bauteile), optimierter Sensorik, Voice Software und intuitiver Mensch Maschine-Interaktion die sichere Navigation in komplexen Umgebungen zu ermöglichen und die Bedienbarkeit weiter zu verbessern.
Projekte aus dem Sommersemester 2025
Studiengang: Applied Life Sciences [Master]
Antragsteller:in: Dr. Sabryna Junker
Antibiotikaresistente Bakterien sind eine stetig zunehmende Herausforderung für das deutsche Gesundheitssystem und werden schätzungsweise bis 2050 weltweit für mehr als 39 Millionen Todesfälle verantwortlich sein. Dennoch gab es seit 1970 nur wenige Durchbrüche in der Antibiotikaforschung und bestehende sowie neue Therapeutika müssen vor allem im klinischen Alltag mit stetig steigender Resistenzentwicklung kämpfen. Der Druck auf die Suche nach neuen Strategien zur Bekämpfung von bakteriellen Pathogenen ist daher groß. Damit verbunden ist die stetige Weiterentwicklung von neuen Methoden zum Testen neuer Therapeutika in der präklinischen Forschung. In den vergangenen Jahren wurde eine völlig neue Methode entwickelt, die es ermöglicht, auch die Wirksamkeit an Wirkorten in Bakterien zu testen, die vorher methodisch nicht zugänglich waren. Diese neue Methode soll nun an der Hochschule Kaiserslautern etabliert werden und in den Lehrbetrieb übernommen werden. Ziel des Projektes ist es daher, Studierende herkömmliche und neue Methoden in der Antibiotikatestung als Forschendes Lernen erarbeiten zu lassen. Die Studierenden erlernen so nicht nur eine neue Methode, die im Zeichen einer innovativen und zeitgenössischen Ausbildung an der HSKL vermittelt wird, sondern erarbeiten sich auch das Verständnis und die Denkweise der Entwicklung von neuen Methoden im Allgemeinen. Das Projekt trainiert das wissenschaftliche Denken und die eigenständige Erarbeitung von zielführenden Herangehensweisen an Brennpunktthemen moderner Forschung.
Studiengang: Digital Engineering, Elektrotechnik, Mechatronik [Bachelor]
Antragsteller:in: Ömer Ata
Die fortschreitende Entwicklung autonomer Fahrsysteme erfordert eine enge Verzahnung von Sensorik, Regelungstechnik und eingebetteter Elektronik, um sicherheitskritische Anwendungen zuverlässig zu realisieren. Insbesondere die Implementierung von Geschwindigkeitsregelungen und Hinderniserkennung stellt eine zentrale Herausforderung dar, da diese Systeme in Echtzeit arbeiten und dabei eine hohe Präzision gewährleisten müssen.
Eingebettete Systeme spielen in diesem Kontext eine Schlüsselrolle, da sie als kompakte und energieeffiziente Recheneinheiten die Grundlage moderner Fahrzeugsteuerungen bilden. Die Erforschung neuer Ansätze in der Sensorintegration, Signalverarbeitung und Regelungstechnologie bietet nicht nur technologische Innovationen, sondern liefert auch wichtige Impulse für die Gestaltung intelligenter Verkehrslösungen. Durch die interdisziplinäre Verknüpfung von Elektronik, Informatik und Automatisierungstechnik trägt diese Forschung wesentlich zur Weiterentwicklung autonomer Mobilität und zur Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen wie Verkehrssicherheit und Ressourceneffizienz bei.
Studiengang: Architektur [Master]
Antragsteller:in: Prof. Dr. Phillip Lionel Molter
Die urbanen Wärmeinseln, hervorgerufen durch dichte Bebauung, Versiegelung und fehlende Vegetation, sind eine zentrale Herausforderung moderner Stadtplanung. Nachhaltige Städtebaukonzepte, die sowohl soziale als auch ökologische Aspekte einbeziehen, spielen dabei eine entscheidende Rolle. Ziel des Projekts ist es, Studierende mit den thermischen Wechselwirkungen von Materialwahl, Vegetation und städtebaulicher Gestaltung vertraut zu machen und ihnen die Möglichkeit zu geben, praktische Lösungsansätze zu entwickeln.
Titel des Projekts: Thermische Analysen und Aufenthaltsqualitäten: Ein innovativer Ansatz zur Lehre von Nachhaltigkeitskonzepten im Städtebau.
Stadtspaziergang als Methode zur Erkundung thermischer Nachhaltigkeitskonzepte im urbanen Raum. Die zunehmenden Auswirkungen des Klimawandels auf urbane Räume, insbesondere in Form von städtischen Wärmeinseln, stellen Städte vor erhebliche Herausforderungen. Nachhaltige Städtebaukonzepte, die auf die thermischen Eigenschaften von Materialien und die Kühlwirkung von Vegetation setzen, sind daher essenziell. Ziel des Projekts ist es, Studierenden grundlegende Prinzipien der thermischen Nachhaltigkeit im Städtebau durch praktische Experimente und Messungen in realen städtischen Situationen zu vermitteln. Die Lehrveranstaltung soll Studierenden ermöglichen, die thermischen Eigenschaften unterschiedlicher städtischer Oberflächen und Materialien zu untersuchen und dabei Erkenntnisse über deren Einfluss auf Aufenthaltsqualitäten und städtisches Mikroklima zu gewinnen.
Studiengang: Studiengänge des Fachbereichs Angewandte Ingenieurwissenschaften
Antragsteller:in: Simon Holzmann
In diesem Projekt sollen die Möglichkeiten untersucht werden Magnetkreise in Verbindung mit PCB-Planarwicklungen für den Einsatz in schnelltaktenden leistungselektronischen Schaltungen durch ein 3D-Druckverfahren herzustellen. Im Gegensatz zu vorangegangen Projekten, soll hierbei der Fokus auf kommerziell erhältlichen Filamenten und Granulat gelegt werden. Zusätzlich soll überprüft werden inwiefern es möglich ist mittels Multi-Material-Druck gezielt einen oder mehrere Luftspalte einzubringen um die magnetischen Eigenschaften positiv zu beeinflussen. Eine weitere Forschungsrichtung ist das Erstellen von Schirmungen für elektromagnetisch Sensitive Bauteile mittels 3D-Druck direkt über dem Bauteil.
Studiengang: Masterstudiengänge des Fachbereichs Bauen und Gestalten
Antragsteller:in: Prof.- Dr.- Ing. Larissa Krieger
Durch den Einsatz nichtrostender Carbonbewehrung können dauerhafte, robuste und langlebige Konstruktionen realisiert werden. Die Fragestellung, ob vorgespannter Carbonbeton hohe Einzellasten, wie sie im Brückenbau auftreten, abtragen kann, möchte ich in einem weiteren Mastermodul WPF K „nichtmetallische Bewehrung“ gemeinsam mit den Studierenden durch die Planung, Durchführung und wissenschaftliche Auswertung experimenteller Bauteilversuche im Sommersemester 2025 herausfinden.
Das dargestellte Forschungsthema ist zudem durch ein großes Interesse aus der Baupraxis geprägt. Die Firma holcim, Produzent vorgespannter Carbonbetonplatten, möchten ihre Produkte auch als neuartige, tragfähige Beläge im Brückenbau einsetzen. Das Thema greift somit eine aktuelle Fragestellung aus der Baupraxis auf. Der Schwerpunkt der experimentellen Untersuchungen wird hierbei auf statisch unbestimmt gelagerten Platten liegen.
Studiengang: Elektrotechnik, Mechatronik [Bachelor] // Elektrotechnik, Informationstechnik, Maschinenbau/Mechatronik [Master]
Antragsteller:in: Nils Szabó, Jennifer Piela
Machine Learning (ML) und Künstliche Intelligenz (KI) gewinnen dank Fortschritten in der Rechenleistung immer mehr an Bedeutung. Mit Anwendungen wie Krebsfrüherkennung oder effizienterem Energieverbrauch sorgen sie für Schlagzeilen, verursachen aber auch hohe Energie- und Rechenkosten. Rechenintensive Algorithmen auf Internetservern sind daher nicht für alle Anwendungen sinnvoll.
Tiny-ML bietet hier eine Lösung, indem es ML auf kleiner Hardware wie Mikrocontrollern oder FPGAs einsetzt. Diese Geräte sind energieeffizient, kostengünstig und leistungsfähig genug für spezifische Anwendungen wie Kontrollsysteme und vorausschauende Wartung. Sie ermöglichen die Vorhersage von Fehlern und Stillständen, verbrauchen jedoch wenig Energie.
Die begrenzte Rechenleistung und der Speicherplatz kleiner Geräte stellen jedoch neue Herausforderungen dar. Deshalb wird geforscht, um effiziente Lösungen für konkrete Anwendungen zu entwickeln. Verschiedene Hardwaretypen und ML-Techniken sollen getestet werden, um praxisnahes Wissen aufzubauen. Als Anwendungsfall dienen leistungselektronische Schaltungen, die überwacht und gesteuert werden können.
Studiengang: Studiengänge des Fachbereichs Angewandte Ingenieurwissenschaften
Antragsteller:in: Kai Franck, Max Wagner
Das grundlegende Ziel dieses Projekts ist die Entwicklung und Untersuchung eines Roboters, der sich auf arachnoide Fortbewegungsmechanismen stützt. Diese Fortbewegungsweise, inspiriert von der Biomechanik von Spinnen, bietet potenziell deutliche Vorteile gegenüber konventionellen Rad- oder Kettenantrieben, insbesondere in unebenem oder schwer zugänglichem Gelände. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Vergleich zwischen den verschiedenen Antriebsarten, um deren Effizienz, Agilität und Anwendbarkeit zu evaluieren.
Studiengang: Digital Media Marketing, Medieninformatik, Angewandte Informatik [Bachelor]
Antragsteller:in: Prof. Dr. Dieter Wallach, Paul Zuspann
Im Fokus der Veranstaltungen «Advanced Topics in Human-Computer Interaction» und «Usability Engineering» stehen jeweils - mit unterschiedlichen, durch die Studiengänge bedingten Schwerpunkten - Vorgehensmodelle und theoretisch-methodische Ansätze zur menschzentrierten Gestaltung interaktiver Systeme und Services. Aktuelle Entwicklungen im Umfeld innovativer AI(Artificial Intelligence)-basierter Tools versprechen eine umfassende Unterstützung zentraler Phasen menschzentrierter Gestaltungsmodelle. Die angesprochene Unterstützung reicht hierbei von der automatisierten Protokollierung, Segmentierung und Klassifikation kontextueller Interviews mit Nutzenden bis zur Durchführung von Interviews mit AI-generierten, „synthetischen“ Usern und der darauf fußenden Erhebung von Bedürfnissen und Ableitung von Nutzungsanforderungen. AI-basierte Generatoren für die Gestaltung von User Interfaces wie „Wireframe Designer“, „UX Pilot“, „UIZARD“ oder „Galileo AI“ suggerieren die Möglichkeit zur Erstellung vollautomatischer Entwürfe von Nutzungsschnittstellen auf der Basis einfacher Prompts zu Nutzungsanforderungen (vgl. Ma, 2024). Die Bandbreite gegenwärtig verfügbarer AI-Tools erlauben dabei sowohl eine zielgerichtete Unterstützung von Kreativtätigkeiten in der Ideation-Phase, als auch die automatisierte Performanzevaluation von Prototypen (Wallach, Fackert & Albach, 2020).
Ziel der beantragten Förderung zum Forschenden Lernen ist es, Studierenden aktuelle AI-Werkzeuge vorzustellen und ihre Möglichkeiten und Grenzen an praxisnahen Beispielen in kollaborativen Settings zu erkunden und zu bewerten. Hierbei kommen sowohl AI-Tools zur Unterstützung der Phasen User Research, als auch Ideation, User Interface Design/Prototyping und Evaluation zum Einsatz.
Studiengang: Architektur, Innenarchitektur, Bauingenieurwesen [Bachelor]
Antragsteller:in: Prof. Dipl.-Ing. Brigitte Al Bosta, Prof. Dr.-Ing. Carina Neff
Die experimentelle Materialforschung im Bauwesen spielt eine entscheidende Rolle in der Entwicklung neuer ökologischer Bauweisen und Konstruktionen, wobei neben den technischen auch innovative ästhetische Konzepte Berücksichtigung finden sollen. Die Kombination traditioneller Baumaterialien mit neuen, nachhaltigen Materialien in der modernen Baukultur soll die Gebäude langlebiger, ressourcenschonender und energieeffizienter gestalten. Stampflehm und Lehmziegelbau sind traditionelle Bauverfahren, die gerade wieder eine ökologisch bedingte Renaissance erlangen. Auf natürliche Weise kalzifizierende, terrestrische Cyanobakterien werden benutzt, um Lebende Bau Materialien (LBMs = living building materials) als Alternative zu herkömmlichen CO2-fixierenden Baustoffen zu entwickeln. Die Forschungen zu LBMs und die Integration von Cyanobakterien zur Erzeugung von alternativen Baustoffen befinden sich noch am Anfang. Die Kombination dieser Baustoffe als nachhaltiger Baustoff bietet ökologische und strukturelle Vorteile:
- Cyanobakterien können durch mikrobiell induzierte Kalzifikation CaCO3 um die Zellhülle anlagern, das als Verstärkung sowohl in betonähnlichen als auch lehmartigen Baustoffen fungiert. Als Zusatzstoff könnten sie zur Verbesserung der Festigkeit und Stabilität von Stampflehmkonstruktionen beitragen und wären somit eine biobasierte Alternative zu Zement, die zudem CO2 speichert. Gleichzeitig könnte somit eine deutlich erhöhte Witterungsbeständigkeit (Reduktion der Erosion durch Wind und Regen) erzielt werden.
- Selbstheilender Lehmbau: Durch die Bildung von Kalziumkarbonat könnten durch wachstumsbildende Strukturen kleine Risse und Schäden selbst repariert werden.
- Die Zugabe von Cyanobakterien könnte die gute Hygroskopizität des Stampflehms weiter optimieren und somit für ein sehr gutes Raumklima ohne Klimaanlage sorgen.
Studiengang: Digital Media Marketing [Bachelor]
Antragsteller:in: Dennis Polier, Timo Altmeyer
Was bringt mehr ChatGPT oder Suchmaschinen - die Zukunft des Digitalen Marketing
Mit der zunehmenden Verbreitung von KI-basierten Plattformen wie ChatGPT zeichnet sich ein signifikanter Wandel in der Art und Weise ab, wie Nutzer Informationen suchen und konsumieren. Suchmaschinen wie Google, die seit Jahrzehnten den Markt dominieren, sehen sich neuen Herausforderungen gegenüber, da die direkte Beantwortung von Fragen durch KI-Systeme und smarte Assistenten neue Erwartungen an Suchergebnisse und Inhalte schafft.
Das Projekt widmet sich der Erstellung von Inhalten mit genartiven Algorithmen / AI sowie der Untersuchung der Ranking- und Empfehlungsverfahren in ChatGPT, um die zugrunde liegenden Kriterien und Algorithmen zu verstehen. Besonders im Fokus steht, wie Inhalte – am Beispiel von Kochrezepten – optimiert werden können, um von ChatGPT erkannt, empfohlen und priorisiert dargestellt zu werden. Die Wahl von Kochrezepten als thematischer Fokus bietet eine ideale Grundlage, da es sich um standardisierte Inhalte handelt, die gut analysierbar und gleichzeitig von hohem praktischen Nutzen sind, ohne dass dafür personenbezogene Daten verarbeitet werden müssen. Neben der Analyse des Status quo sollen Strategien entwickelt werden, um prototypisch die Sichtbarkeit und Relevanz von Rezeptportalen im Vergleich zu Chefkoch.de, Kochbar.de oder Lecker.de in ChatGPT zu erhöhen.
Dieses Forschungsthema vereint Fragestellungen der digitalen Medien, des Marketings, der Künstlichen Intelligenz und der KI-Optimierung. Es leistet einen Beitrag zum Verständnis von KI-gestützten Rankings und bietet praktische Handlungsempfehlungen - für die Lehre, aber auch für die Hochschule - für die zukünftige Anpassung von Inhalten an die neuen Anforderungen der digitalen Plattformen.
Studiengang: Maschinenbau, Elektrotechnik, Energie-Ingenieurswesen, Mechatronik, Wirtschaftsingenieurswesen
Antragsteller:in: Janina Koziol
Stähle und weitere metallische Materialien finden eine breite Anwendung in zahlreichen industriellen Bereichen, einschließlich der Automobilindustrie, der Luft- und Raumfahrt sowie der Energieerzeugung. Die Kenntnis hinsichtlich ihrer Ermüdungseigenschaften ist entscheidend, um die Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Bauteilen vorherzusagen und zu optimieren. Dabei hängt das zyklische Verformungsverhalten von einer Vielzahl von Faktoren ab, die sich wiederum gegenseitig beeinflussen können. Als typische Vertreter solcher Einflussfaktoren sind bspw. der Werkstoff selbst und dessen Mikrostruktur als Träger seiner Eigenschaften, aber auch z. B. die Beanspruchungsfrequenz, -amplitude oder während der Probenherstellung in das oberflächennahe Gefüge eingebrachte Eigenspannungen zu nennen, die sich charakteristisch auf das Ent- und/oder Verfestigungsverhalten und die Lebensdauer auswirken.
Die während des Ermüdungsprozesses ablaufenden mikrostrukturellen Änderungen lassen sich mittels hochauflösender Rasterelektronenmikroskopie abbilden, wobei klassischer Weise Proben in einem Ermüdungsprüfstand ex-situ ermüdet und erst nach ihrem Versagen und einer nachfolgenden zerstörenden Präparation, mittels Rasterelektronenmikroskop (REM) hochauflösend mikrostrukturell untersucht werden. Moderne in-situ Zug-Druck-Module (ZDM), die innerhalb der Probenkammer eines REM eine zyklische Beanspruchung von Proben, also auch ohne vorherige zerstörende Präparation, realisieren können, ermöglichen darüber hinaus eine unmittelbare Betrachtung der zur Ermüdung führenden Mikrostrukturevolution und machen somit die ablaufenden Prozesse, die von verschiedenen Einflussfaktoren abhängen können, direkt zugänglich.
Kontakt

Kontakt
- +49 631 3724-5274jessica.weyer(at)hs-kl(dot)de
- Campus Zweibrücken
- Raum G 227
Fördervoraussetzungen
- Die Projekte können in die Wahlpflichtveranstaltung eines Bachelor- oder Masterstudiengangs integriert oder zusätzlich zum Curriculum angeboten werden.
- Die Beantragung der Mittel kann durch Studierende, Promovierende, Professor: innen und Lehrende erfolgen; Mentor: innen sollen die Projekte fachlich begleiten.
- Das ausgefüllte Antragsformular wird bis zum bekanntgegebenen Stichtag für eine Veranstaltung im darauffolgenden Semester bei Frau Dr. Jessica Weyer eingereicht.
- Details finden Sie im Informationsblatt (s.o.).
Förderung
Aus Landesmitteln des Landes Rheinland-Pfalz hat die Hochschule Kaiserslautern einen eigenen Fördertopf (Fond) initialisiert. Aus diesem Fond können pro Semester forschungsnahe Lehrangebote mit einem Budget für Sach- und Hiwi-Mittel mit bis zu 3.000 € (in der Regel) gefördert werden.
Die Ausschreibung startet jeweils zum Semesterbeginn, zur objektiven Bewertung der Anträge und somit zur Qualitätssicherung der Projekte wurde unter anderem eine Arbeitsgruppe „Forschendes Lernen“ an der Hochschule etabliert.